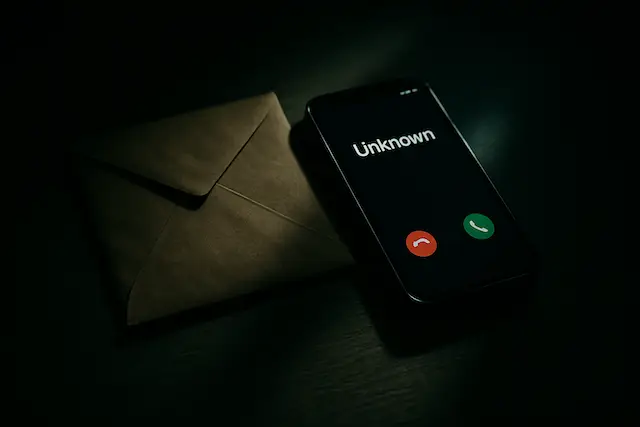Einstellung nach § 153 und § 153a StPO
Wenn ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wird, bedeutet das für Betroffene meist eine große psychische Belastung. Doch nicht jedes Verfahren endet mit einer Anklage oder gar einer Verurteilung. In vielen Fällen kann es auch eingestellt werden – insbesondere nach § 153 oder § 153a der Strafprozessordnung (StPO). Doch was genau bedeutet das? Und was ist der Unterschied zwischen den beiden Vorschriften?

Was bedeutet eine Einstellung nach § 153 StPO?
§ 153 StPO erlaubt es der Staatsanwaltschaft, ein Strafverfahren einzustellen, wenn die Schuld als gering anzusehen ist und kein öffentliches Interesse an der Strafverfolgung besteht. Voraussetzung ist außerdem, dass es sich um ein Vergehen handelt – also um eine Straftat, die mit Geldstrafe oder mit Freiheitsstrafe von unter einem Jahr bedroht ist.
Diese Art der Einstellung kann auch dann erfolgen, wenn bereits ein Anfangsverdacht vorliegt. Es findet dann keine Anklage statt, und es kommt nicht zu einer Hauptverhandlung vor Gericht. Der Beschuldigte gilt weiterhin als unschuldig – denn es wurde keine Schuld festgestellt.
Was ist eine Einstellung nach § 153a StPO?
Eine Einstellung nach § 153a geht einen Schritt weiter: Hier kann die Staatsanwaltschaft das Verfahren unter bestimmten Bedingungen einstellen – zum Beispiel gegen eine Geldauflage oder unter der Bedingung, dass der Beschuldigte einen bestimmten Betrag an eine gemeinnützige Organisation zahlt. Diese Möglichkeit besteht ebenfalls nur bei Vergehen und wenn die Schuld nicht als schwerwiegend einzustufen ist.
Im Unterschied zur Einstellung nach § 153 muss der Beschuldigte dieser Verfahrensweise ausdrücklich zustimmen. Nach erfolgreicher Erfüllung der Auflagen wird das Verfahren endgültig eingestellt – ohne Urteil, aber mit der Folge, dass dieselbe Tat nicht noch einmal verfolgt werden kann.
Worin liegt der Unterschied zwischen beiden Einstellungen?
Der wesentliche Unterschied liegt in der Mitwirkung des Beschuldigten. Bei einer Einstellung nach § 153 entscheidet allein die Staatsanwaltschaft – oft sogar ohne, dass der Betroffene davon erfährt. Bei § 153a hingegen muss der Beschuldigte zustimmen und bestimmte Auflagen erfüllen.
Zudem hat die Einstellung nach § 153a weitergehende Folgen: Wird das Verfahren erfolgreich beendet, besteht ein sogenannter Strafklageverbrauch – das bedeutet, dass wegen derselben Tat nicht noch einmal ein Verfahren geführt werden darf. Das gilt aber nur, wenn die Auflagen vollständig erfüllt wurden.

Praxisbeispiel: Wann kommt eine Einstellung infrage?
Angenommen, ein Mann wird beschuldigt, in einem Supermarkt einen Artikel im Wert von 20 Euro entwendet zu haben. Er ist bislang nicht vorbestraft und zeigt sich einsichtig. Die Staatsanwaltschaft prüft, ob ein öffentliches Interesse an einer Anklage besteht – und entscheidet sich dagegen. Das Verfahren wird nach § 153 StPO eingestellt.
Wäre der Schaden etwas höher oder hätte der Mann sich zuvor auffällig verhalten, könnte die Staatsanwaltschaft eine Einstellung nach § 153a StPO vorschlagen – etwa unter der Bedingung, dass er 200 Euro an eine gemeinnützige Organisation zahlt. Stimmt er zu und zahlt den Betrag fristgerecht, wird das Verfahren eingestellt.
Was bedeutet „geringe Schuld“?
Ob eine Schuld als gering anzusehen ist, hängt von den Umständen des Einzelfalls ab. Maßgeblich sind unter anderem der entstandene Schaden, das Verhalten des Beschuldigten und mögliche Vorstrafen. Als grobe Orientierung kann gelten: Je niedriger der Schaden und je geringer die kriminelle Energie, desto eher kommt eine Einstellung in Betracht.
Welche Rolle spielt das öffentliche Interesse?
Ein Verfahren wird nur dann eingestellt, wenn kein öffentliches Interesse an einer Strafverfolgung besteht. Dabei geht es nicht um mediale Aufmerksamkeit, sondern um die Frage, ob aus Sicht der Allgemeinheit eine strafrechtliche Aufarbeitung notwendig erscheint – etwa zur Abschreckung oder zum Schutz Dritter.
Welche Auflagen sind bei § 153a möglich?
Typische Auflagen sind Geldzahlungen an gemeinnützige Einrichtungen, Entschuldigungen beim Opfer oder soziale Leistungen wie die Teilnahme an einem Trainingskurs. Welche Auflagen genau in Betracht kommen, hängt von der Art der Tat und den persönlichen Umständen des Beschuldigten ab. Die Erfüllung muss innerhalb einer bestimmten Frist erfolgen – meist innerhalb von sechs Monaten.
Welche Vorteile hat eine Einstellung?
Für viele Beschuldigte ist eine Einstellung – ob nach § 153 oder § 153a – die beste Lösung. Es kommt zu keiner Verurteilung, das Verfahren wird ohne Gerichtsverhandlung beendet, und in der Regel entstehen keine Einträge im Bundeszentralregister. Gerade bei einmaligen Verfehlungen ist dies ein milder und praktikabler Weg.

Häufige Fragen zur Einstellung nach § 153 und § 153a StPO
Steht die Schuld bei einer Einstellung fest?
Nein. Weder bei einer Einstellung nach § 153 noch nach § 153a erfolgt eine Feststellung der Schuld. Es handelt sich um eine pragmatische Lösung, kein Schuldeingeständnis.
Was passiert, wenn ich die Auflagen nicht erfülle?
Wird eine Auflage aus § 153a nicht oder nicht fristgerecht erfüllt, wird das Verfahren wieder aufgenommen. Dann kann es zu einer Anklage und einer Verurteilung kommen.
Kann ich die Einstellung ablehnen?
Bei § 153 ist keine Zustimmung erforderlich – das Verfahren kann unabhängig vom Willen des Beschuldigten eingestellt werden. Bei § 153a hingegen ist die Zustimmung zwingend notwendig. Ohne diese erfolgt keine Einstellung.
Anzeige erhalten?
Wenn Sie eine Anzeige erhalten haben, kann eine Einstellung nach § 153 oder § 153a eine sinnvolle Möglichkeit sein, das Verfahren ohne langwierige Prozesse zu beenden. Ob dies in Ihrem Fall in Betracht kommt, hängt von vielen Faktoren ab – etwa dem Tatvorwurf, Ihrer Vorgeschichte und dem Verfahrensstand. Eine fundierte rechtliche Einschätzung ist hier besonders wichtig.