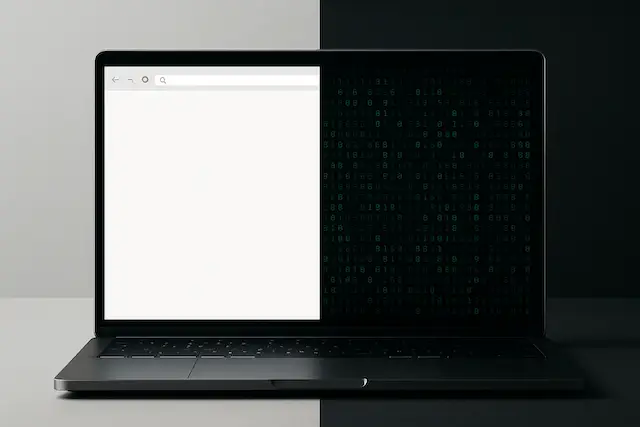Was ist die „schwere Körperverletzung“?
Bei der schweren Körperverletzung nach § 226 Strafgesetzbuch (StGB) wird nicht – wie bei der gefährlichen Körperverletzung (§ 224 StGB) – auf das eingesetzte Tatmittel oder die Art der Begehungsweise abgestellt, sondern es geht um die schweren Folgen der Tat.
Eine schwere Körperverletzung liegt vor, wenn der Täter das Opfer vorsätzlich körperlich misshandelt oder an der Gesundheit schädigt und hierdurch eine schwere (gesundheitliche) Folge beim Opfer eintritt.
Wann ist die „schwere Körperverletzung“ strafbar?
Der Straftatbestand schützt die körperliche Unversehrtheit und das körperliche Wohlbefinden des Opfers.
Die schwere Körperverletzung setzt eine (einfache) Körperverletzung nach § 223 StGB voraus und bildet mit § 226 StGB einen sog. Qualifikationstatbestand. Liegt eine der Nummern des ersten Absatzes von § 226 StGB vor, erhöht sich der Strafrahmen wesentlich.
Grundtatbestand: § 223 StGB
Zunächst muss der Täter eine (einfache) Körperverletzung im Sinne des § 223 StGB begehen. Er muss also das Opfer vorsätzlich, also mit Wissen und Wollen, körperlich misshandeln oder an dessen Gesundheit schädigen.
Qualifikation: § 226 StGB
Durch diese körperliche Misshandlung oder Gesundheitsschädigung muss eine schwere (gesundheitliche) Folge beim Opfer eingetreten sein. Diese Folge muss unmittelbar aus der Tat – also der Körperverletzung – resultieren. Dabei zählt der § 226 StGB in drei Nummern die schweren Folgen auf.

Verlust von Sinnes- oder Körperfunktionen (Nr. 1)
Die schweren Tatfolgen nach § 226 Abs. 1 Nr. 1 StGB behandeln den Verlust bestimmter Sinnes- oder Körperfunktion.
So liegt eine schwere Körperverletzung vor,
- bei dem Verlust eines oder beider Augen
- bei der Verminderung des Sehvermögens auf unter 10 %
- bei dem Verlust des Gehörs (gemeint ist der Verlust der Fähigkeit, artikulierte Laute akustisch zu verstehen)
- bei dem Verlust des Sprechvermögens (gemeint ist die Fähigkeit zu artikuliertem Reden)
- bei dem Verlust der Fortpflanzungsfähigkeit (gemeint ist die Zeugungs-, Empfängnis- und Gebärfähigkeit)
Verlust eines wichtigen Körpergliedes (Nr. 2)
Die zweite Gruppe der schweren Verletzungsfolgen nach § 226 Abs. 1 Nr. 2 StGB behandelt den Verlust oder die dauerhafte Gebrauchsunfähigkeit eines wichtigen Körpergliedes.
Körperglieder sind solche Körperteile, die durch Gelenk mit dem Körper verbunden sind, also Arme, Beine oder Finger. Die Frage, ob es sich um ein wichtiges Glied handelt, hängt sowohl von der objektiven Gesamtfunktion im Körper als auch von individuellen Bedürfnissen des Verletzten ab.
So ist ein Arm wohl stets ein wichtiges Glied, ein Finger oder Zeh aber nicht in jedem Fall. Der Verlust oder die Versteifung des rechten Zeigefingers kann bei einem Pianisten eine schwere Körperverletzung darstellen. Auch der Verlust des kleinen Fingers kann den Tatbestand der schweren Körperverletzung verwirklichen, wenn das Opfer bereits vorher nur noch einen Daumen und kleinen Finger an einer Hand hatte.
Keine Körperglieder sind innere Organe wie die Niere oder Körperteile, die nicht durch Gelenke mit dem Körper verbunden sind (Nase). Diese erfüllen zwar eine wichtige Funktion im Gesamtorganismus, unterfallen – nach Auffassung des Bundesgerichtshofes – allerdings nicht dem Tatbestand des § 226 StGB.
Dauerhafte Entstellung, Siechtum, Lähmung, geistige Krankheit oder Behinderung (Nr. 3)
Die letzte Gruppe der schweren Körperverletzung findet sich in § 226 Abs. 1 Nr. 3 StGB. Danach handelt es sich um eine schwere Körperverletzung, wenn das Opfer in erheblicher Weise dauerhaft entstellt wird oder in Siechtum, Lähmung oder geistige Krankheit oder Behinderung verfällt.
Dauerhafte Entstellung
Eine erhebliche, dauerhafte Entstellung liegt vor, wenn das äußere Erscheinungsbild auf unbestimmte Zeit ästhetisch beeinträchtigt ist.
Eine dauerhafte Entstellung wurde anerkannt bei
- Verlust eines Nasenflüges
- Verlust eines (halben) Ohres
- Gehbehinderung
- herunterhängendem Augenlid
- schwere Brandverletzungen
- Verlust einer Vielzahl von Zähnen
Eine dauerhafte Einstellung kann auch bei dem Zurückbleiben einer Narbe vorliegen. Hier kommt es aber maßgeblich auf die besonderen Umstände des Einzelfalls an, ob bereits die Schwelle zu einer schweren Körperverletzung (und die damit verbundene hohe Strafandrohung) überschritten ist.
Siechtum
Unter Siechtum wird ein Zustand verstanden, bei dem das Opfer aufgrund der Körperverletzung in einen zeitlich nicht absehbaren chronischen Krankheitszustand verfällt, der den ganzen menschlichen Organismus erfasst. Dies kann bei dem Infizieren mit HIV in Betracht kommen.
Lähmung
Eine Lähmung liegt vor, wenn die Bewegungsfähigkeit eines Körperteils verloren ist, was sich nachteilig auf die Bewegungsfähigkeit des ganzen Körpers auswirkt.
Geistige Krankheit oder Behinderung
Schließlich macht man sich der schweren Körperverletzung strafbar, wenn die Körperverletzung zu einer Geisteskrankheit oder einer geistigen Behinderung des Opfers führt.
Vorsatz
Die meisten Straftatbestände setzen einen Vorsatz beim Täter voraus. Fehlt es an einem solchen, bedarf es einer Strafbarkeit wegen Fahrlässigkeit, die das Gesetz aber konkret vorschreiben muss.
Bei der schweren Körperverletzung ist zu differenzieren. So muss die Körperverletzung an sich vorsätzlich erfolgen. Der Täter muss diese also mit Wissen und Wollen des Straftatbestandes verwirklicht haben. Hierbei ist ausreichend, dass er den Straftatbestand billigend in Kauf genommen und zumindest für möglich gehalten hat (sog. Eventualvorsatz). Hinsichtlich des Herbeiführens der schweren Folge genügt jedoch fahrlässiges Handeln.
Fehlt es bereits am Vorsatz hinsichtlich der Körperverletzungshandlung, kommt allenfalls eine Strafbarkeit wegen fahrlässiger Körperverletzung nach § 229 StGB in Betracht.
Kommt es beispielsweise im Rahmen eines Verkehrsunfalls beim Unfallopfer zu einer der genannten schweren Folgen, wird es „lediglich“ zu einem Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung kommen, wenn – wie regelmäßig – kein Vorsatz hinsichtlich des verursachten Verkehrsunfalls vorliegt.
Bei Unfällen im Rahmen von illegalen Straßenverkehrsrennen wurde im Rahmen eines „Raser-Falles“ aber jüngst sogar das Vorliegen eines Tötungsvorsatzes vom Bundesgerichtshof bestätigt!

Verursacht der Täter aber nicht nur die Körperverletzung vorsätzlich, sondern auch die schwere Folge, so erhöht sich die Strafe maßgeblich.
Anders als die gefährliche Körperverletzung knüpft diese Deliktsform nicht an die Tathandlung, sondern an die besonders schweren Tatfolgen an. Eine schwere Körperverletzung liegt daher vor, wenn der Verletzte ein Bein oder einen Finger verliert oder blind wird.
Einwilligung
Das Opfer kann in die schwere Körperverletzung einwilligen, vgl. § 228 StGB. Diese Einwilligung führt dazu, dass sich der Täter nicht strafbar macht.
Die Einwilligung muss bei vollem Verständnis der Sachlage erfolgt und nicht erschlichen worden sein. Möglich sind Einwilligungen beispielsweise bei Eingriffen von Ärzten, beim Fußballspiel sowie anderen Sportarten (Boxen, Karate etc.), aber auch bei bestimmten Sexualpraktiken („Sado-Maso“).
Versuch
Der Versuch ist nach §§ 226 Abs. 1, 23 Abs. 1, 12 Abs. 1 StGB strafbar. Ein Versuch liegt bereits dann vor, wenn der Täter nach seiner Vorstellung von der Tat zur Verwirklichung des Tatbestandes unmittelbar angesetzt hat (§ 22 StGB). Hierfür muss der Täter die Schwelle zum „Jetzt-geht’s-los“ überschritten haben und es muss unmittelbar eine Rechtsgutsgefährdung bevorstehen. Dabei muss der Täter hinsichtlich des Eintritts der schweren Folge diese billigend in Kauf genommen und zumindest für möglich gehalten hat (sog. Eventualvorsatz).
Strafantrag
Bei der schweren Körperverletzung handelt es sich um ein sogenanntes Offizialdelikt. Das bedeutet, dass eine solche Straftat durch die Strafverfolgungsbehörde (Staatsanwaltschaft) bei Kenntniserlangung von Amts wegen verfolgt wird. Ein Antrag durch den Geschädigten oder dessen gesetzlichen Vertreter ist daher nicht erforderlich.
Strafe
Die schwere Körperverletzung wird mit einer Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren bestraft. Eine Geldstrafe ist nicht möglich.
Eine Strafmilderung ist in minder schweren Fällen – abhängig von den Umständen des Einzelfalles – möglich.
Häufige Fragen
- Verlust der Nasenspitze
- Verlust der Ohrmuschel
- Verlust der Vorderzähne
- Zurückbleiben störender Narben im Gesicht
.
Wenn durch eine Körperverletzung das Opfer einen Finger (insbesondere Daumen oder Zeigefinger) verliert, kann eine schwere Körperverletzung nach § 226 Abs. 1 StGB vorliegen.
.
Wenn mehrere schwere Folgen verursacht werden, ist trotzdem nur eine Tat verwirklicht. Aber dies wird bei der Strafzumessung berücksichtigt.
.
Die Definitionen beider Körperverletzungsdelikte gehen maßgeblich auseinander. Die gefährliche Körperverletzung stellt auf die Begehungsweise der Tat ab und die schwere Körperverletzung auf die Folgeschäden der Tat.
Kurz gesagt: Nein! Es gibt lediglich die Körperverletzung mit Todesfolge (§ 227 StGB). Das bedeutet, dass soweit der Tod des Opfers eintritt, die Art und Weise der Körperverletzung nicht mehr beachtlich ist.
Bei einer schweren Körperverletzung nach § 226 StGB wird mit einer Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren bestraft. Eine Geldstrafe ist nicht möglich.
Die schwere Körperverletzung verjährt nach zehn Jahren ab Beendigung der Tat (§ 78 Abs. 3 S. 3 StGB).